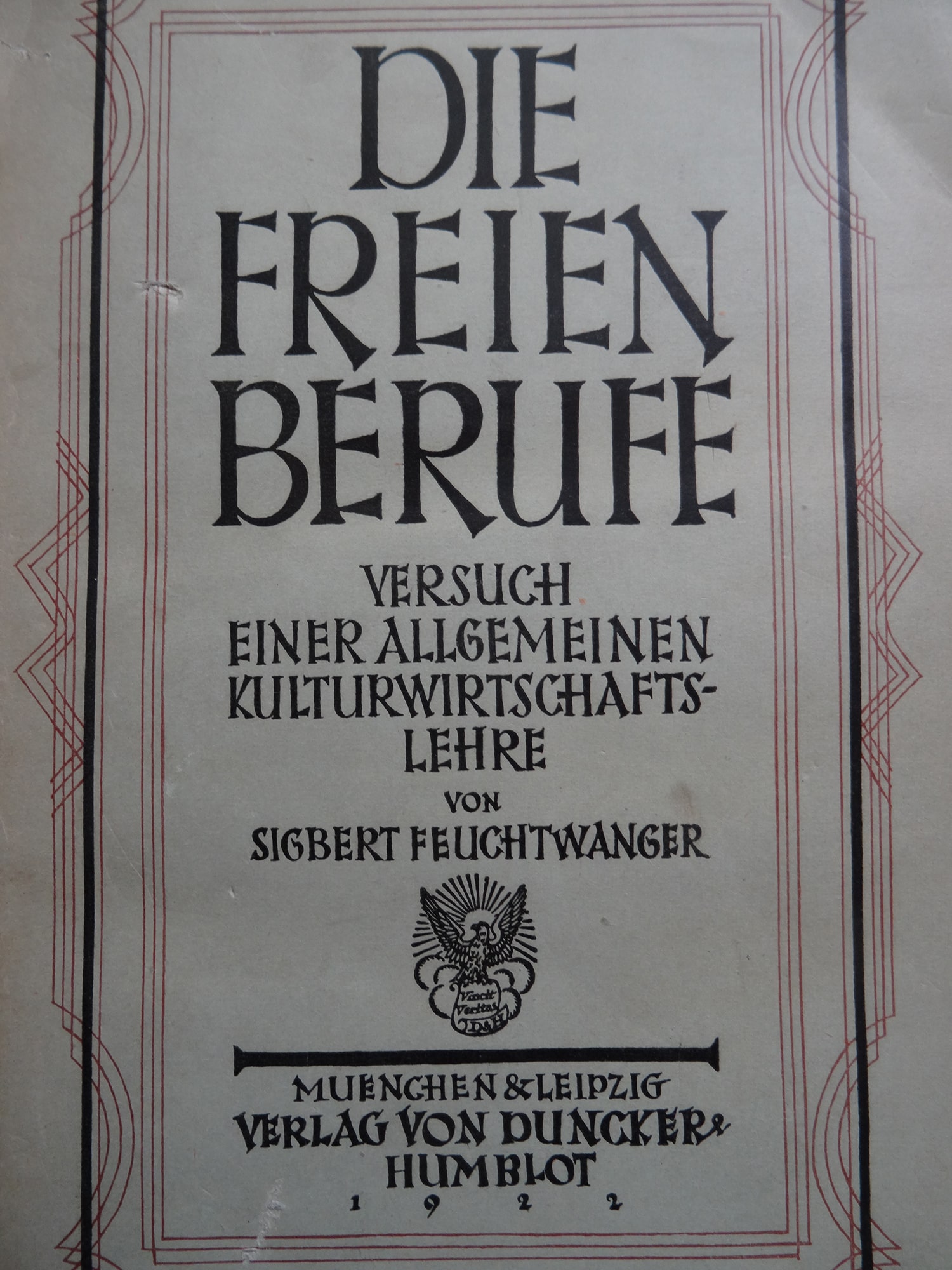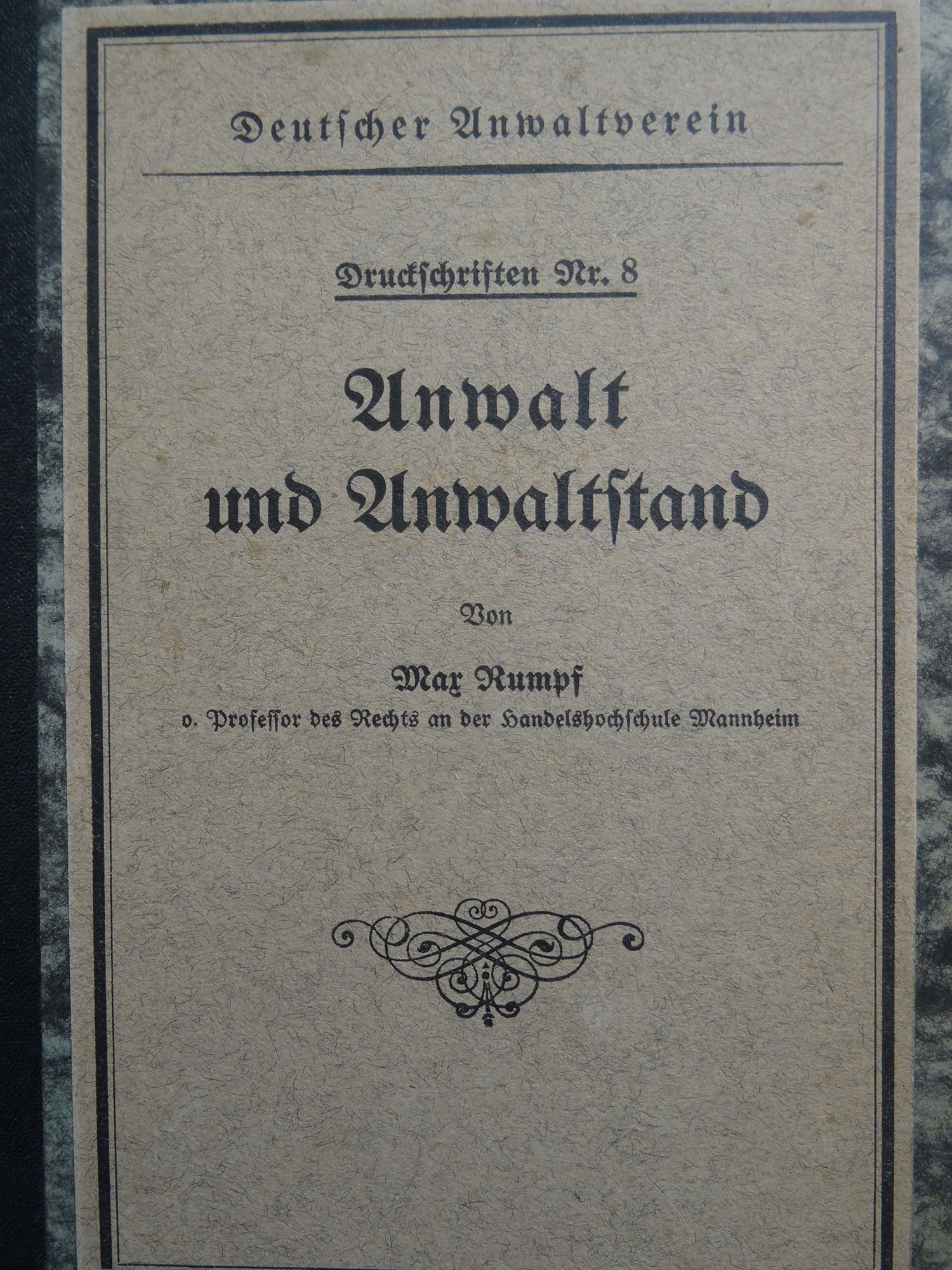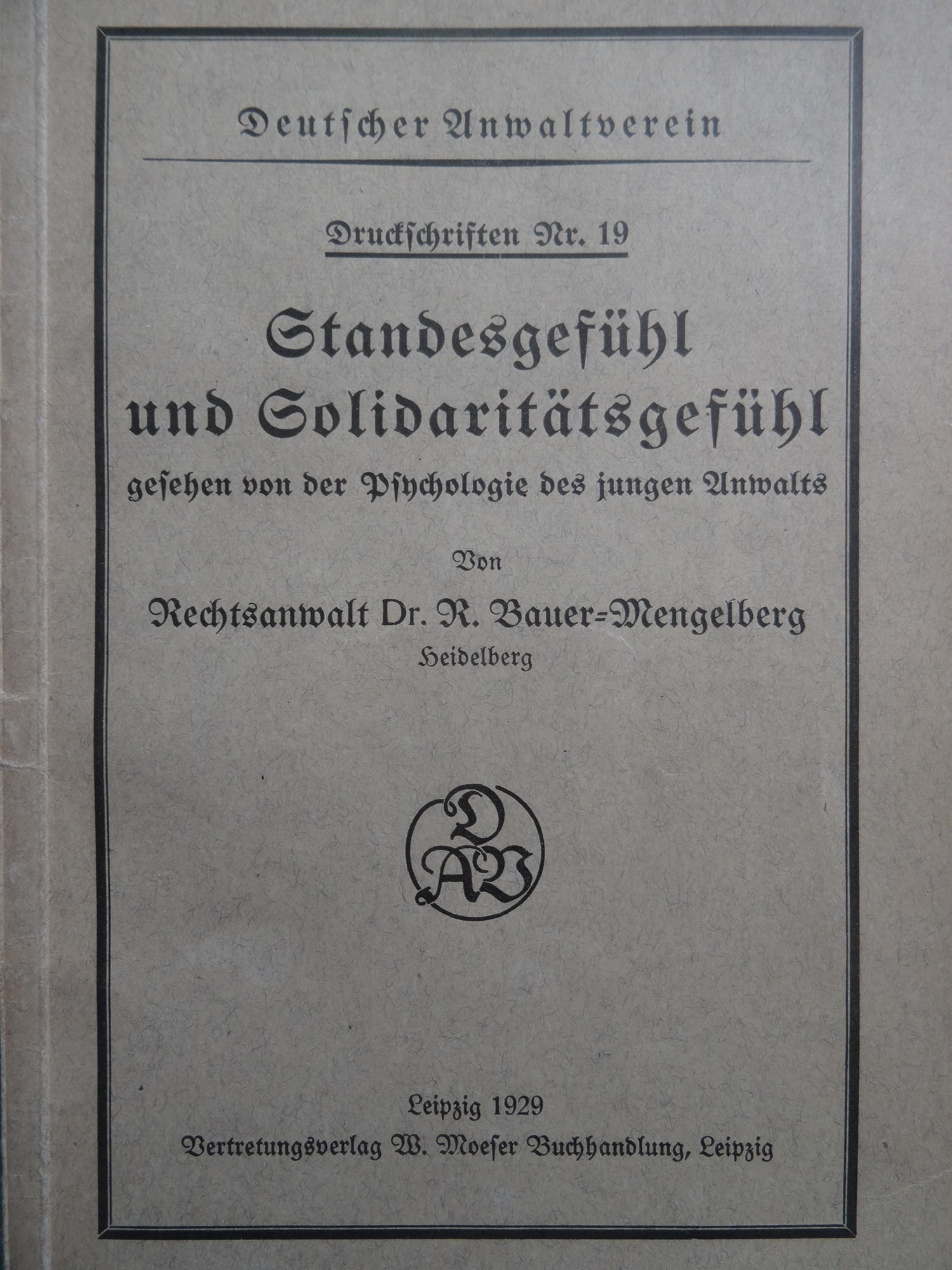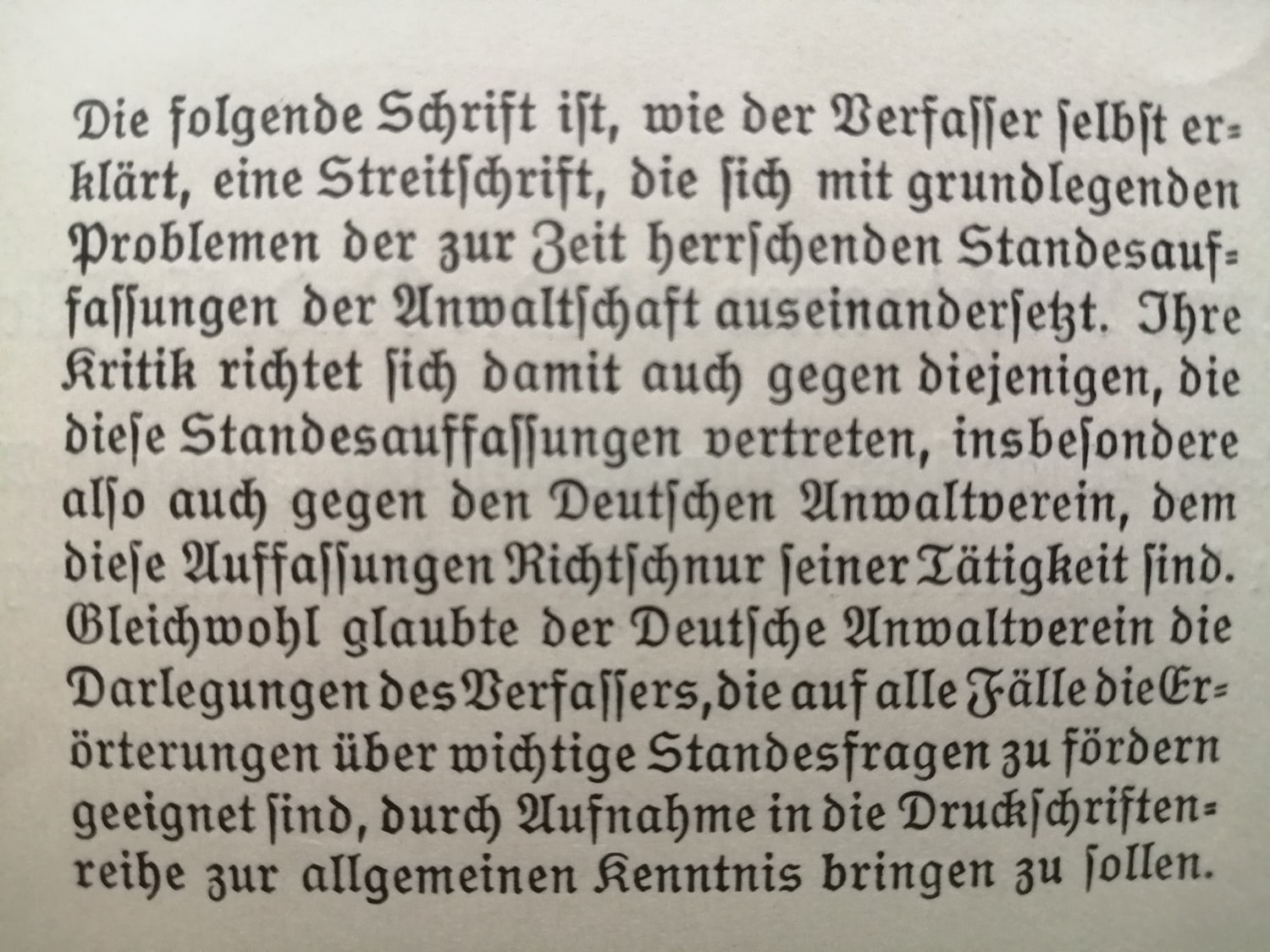...dass das Publicum ein Recht auf den Beirath rechtskundiger Sachwalter in freier Concurrenz hat...
(Rudolf Gneist, Freie Advocatur, 1867)
Soziologie der Anwaltschaft in den 1920er Jahren
Sigbert Feuchtwanger, Max Rumpf, Rudolf Bauer-Mengelberg
Sigbert Feuchtwanger
Zur Person:
Geboren 1886 in München, verstorben 1956 in Haifa. Zulassung als RA 1913, Verzicht Ende 1936. Im selben Jahr Emigration nach Palästina. 1927 bis 1933 im Vorstand der Münchener Rechtsanwaltskammer, ab 1933 2. Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde München (vgl. Reinhard Weber, Das Schicksal der jüdischen Rechtsanwälte in Bayern nach 1933, München 2006, S. 228 f (mit zahlr. weiteren Nachw.). Zu seinen Veröffentlichungen siehe auch hier https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/person/gnd/116482699
Max Rumpf
„Anwalt und Anwaltstand“ ist 1926 als Nr. 8 der Druckschriftenreihe des Deutschen Anwaltvereins erschienen.
Zur Person:
Geboren 1878 in Berne, gestorben 1953 in Haar. 1906 Habilitation in Göttingen (Römisches und Bürgerliches Recht), zunächst aber im Justizdienst, 1908 Privatdozent in Göttingen, 1912 Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Handelsrecht an der Handelshochschule Mannheim, 1927 Lehrstuhl für Bürgerliches Recht und Wirtschaftsrecht an der (Handels-)Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in Nürnberg (ab 1933 Hindenburg-Hochschule). 1939 Emeritierung und Übersiedlung nach München. Anhänger der Freirechtschule, seit den 1920er Jahren Beschäftigung mit der Verknüpfung von Soziologie und Recht („Volksrechtswissenschaft“). Nach 1933 starke Nähe zum NS und zu „sozialromantischen, völkischen, auch antisemitischen Ordnungsvorstellungen“. Näheres bei Hans-Peter Haferkamp in der NDB 22 (2005), S. 254-255, https://www.deutsche-biographie.de/gnd116706333.html#ndbcontent.
Hannes Siegrist befasst sich in seiner 1996 erschienenen Studie „Advokat, Bürger und Staat – Sozialgeschichte der Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und der Schweiz“ ausführlich mit den Werken von Feuchtwanger und Rumpf (2. Halbband, S. 655 – 666). Auszug:
Der Versuch von Rumpf, das Standesrecht als System zu begreifen, lief darauf hinaus, dass er das Selbstverständnis, eine bestimmte Berufsideologie und die normativ-institutionellen Regulierungen der Rechtsanwaltschaft soziologisch paraphrasierte. Sein Werk wurde nicht zuletzt deshalb in den Führungskreisen des Deutschen Anwaltvereins sehr geschätzt, und es bildete eine der Grundlagen der standestheoretischen Arbeiten des DAV, der 1929 die Ehrengerichtsurteile in geordneter Form veröffentlichte (Beilage zu JW 1929 Heft 6). Die später in Vergessenheit geratene Studie kann trotz ihrer Mängel als eines der frühesten modernen professionssoziologischen Werke bezeichnet werden. Ihr wichtigstes Defizit besteht darin, dass die aus verschiedenen Zeiten und Verhältnissen stammenden Verhaltensregeln und Leitbilder nicht historisch-kritisch analysiert und in die Berufs- und Gesellschaftsgeschichte eingebettet werden (660).
Feuchtwanger kritisierte an der Standesrechtsprechung, dass es ihr nur die Sicherung der Würde des Standes gehe, d. h. um das äußere Ansehen des gesamten Berufsstandes. Die Problematik der individuellen Ehre und Lage finde dagegen kaum Beachtung. Die traditionalistische und elitäre Standesethik lenke von der Tatsache ab, dass in wirtschaftlich schweren Zeiten größere Teile der Anwaltschaft nicht mehr selbstverständlich über jene materielle Basis verfügten, die man brauche, um das Uneigennützigkeitsgebot wirklich befolgen zu können (660 f). […] Deshalb sei die Konzeption der Standeswürde, die um den Begriff der ständischen Ehre kreise, durch eine „materielle Standestheorie“ zu ersetzen, die das Vertrauen zwischen dem Anwalt und den Klienten in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. […] Feuchtwanger lehnte jede Staatsintervention, selbst die Vergabe von Titeln und Orden an Rechtsanwälte, ab, weil dadurch die ständischen Prinzipien von Autonomie, Selbstverwaltung und Eigengerichtsbarkeit infrage gestellt würden. […] (661). Anders als die meisten seiner deutschen Zeitgenossen thematisierte Feuchtwanger den Rechtsanwaltsberuf […] nicht primär als staatlich akkreditierten „akademischen Beruf“ und Teil des „Akademikerstandes“, sondern als „freien und geistigen Beruf“. Indem er konsequent zwischen den Beamten den freien Berufen unterschied, löste er sich von den Denkmustern des 19. Jahrhunderts und knüpfte er ein Stück weit an die alteuropäische Konzeption des liberalen Berufs an, in welcher der Staat keine primäre Rolle spielte (662).
Feuchtwanger und Rumpf reflektierten in unterschiedlicher Weise die Lage, die Werte und Einstellungen der damaligen Rechtsanwaltschaft. Beide gingen ganz selbstverständlich davon aus, dass die Anwaltschaft ein Stand sei, der in der schwierigen Übergangsperiode nach 1918 die Werte und Interessen seiner Angehörigen zu verteidigen habe. In der von politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Umbrüchen und Krisen gekennzeichneten Weimarer Republik setzte Rumpf – zusammen mit vielen anderen – auf die ‚bewährten‘ Werte. Feuchtwanger dagegen versuchte in offensiver Weise die soziale Figur des Freiberuflers aufzuwerten. Gleichzeitig strebte er eine Lösung der wirtschaftlichen Probleme der Rechtsanwälte an, indem er das in den deutschen (klein-) bürgerlichen Mittelschichten populäre Konzept der Wirtschaftsgenossenschaft mit dem Prinzip der Standesgenossenschaft verknüpfte. Nach Feuchtwanger hatte der „Stand“ die Aufgabe, die Defizite und Fehlentwicklungen einer individualistischen und kapitalistischen Ordnung zu kompensieren und zu korrigieren. Seine moderne Konzeption des Berufsstandes unterschied sich ganz erheblich von den damals wiederbelebten romantisch-ständischen Vorstellungen und von der faschistischen Korporationsidee. „Stand“ war für ihn allerdings immer mehr als bloß ein moderner „Interessenverband“ (665).
Feuchtwanger war als Professionssoziologe zweifellos kreativer und innovativer als Rumpf, als jüdischer Autor war er nach 1933 jedoch geächtet (664).
Rudolf Bauer-Mengelberg
„Standesgefühl und Solidaritätsgefühl“ ist 1929 als Nr. 19 der Druckschriftenreihe des Deutschen Anwaltvereins erschienen
Zur Person:
Geboren 1898 in Karlsruhe, Rechtsanwalt in Heidelberg (Sozietät mit F. Spitz und E. Wellbrock). Mai 1933 gemeinsam mit zweiter Ehefrau Gerda (geb. Caspary) Flucht nach Frankreich, 1939 Ausbürgerung und Emigration nach Argentinien. Galt im NS als „Mischling 1. Grades“. Aus Unterlagen der Gestapo: „Bauer-Mengelberg war früher Mitglied der SPD. Er hat durch betrügerische Machenschaften mitgeholfen, eine große Anzahl von deutschen Volksgenossen schwer zu schädigen. Die Voraussetzungen für die Aberkennung seiner Reichsangehörigkeit und Erstreckung auf die Ehefrau sind daher gemäß Erlass des Reichsführers SS […] vom 30. März 1937 […] erfüllt.“ (Quelle: Martin Schumacher, Ausgebürgert unter dem Hakenkreuz. Rassisch und politisch verfolgte Rechtsanwälte, Münster 2021, I. Falldokumentation S. 11 f)
Es ist zweifellos bemerkenswert, dass der DAV einem 31jährigen Rechtsanwalt aus Heidelberg diese Bühne geboten hat. Der Autor stellt allerdings schon zu Beginn klar, dass mit dem titelgebenden „jungen“ Anwalt der „normativ-junge“, nicht der „empirisch-junge“ Rechtsanwalt gemeint ist. „Wir beschäftigen uns mit den psychologischen Problemen, die aus einer modernen Einstellung zu den typisch anwaltlichen Fragen entstehen.“ Aus der einschlägigen Literatur wolle er nur auf zwei zentrale Werke Bezug nehmen, nämlich auf „Anwalt und Anwaltstand“ von Max Rumpf und das „große Buch“ von Sigbert Feuchtwanger. Rumpf beschränke sich allerdings auf eine unkritische Wiedergabe der ehrengerichtlichen Rechtsprechung (38). Und Feuchtwanger habe zwar die Mängel des geltenden Anwaltssystems oft richtig erkannt und scharf formuliert, trotzdem sei die Arbeit als praktische Anregung unbrauchbar, denn sie sei nicht nur zu umfangreich, sondern es handele sich letztlich um eine Utopie: Dem Buch fehle der Wirklichkeitssinn und die Verwirklichungsmöglichkeit (13).
Bauer-Mengelberg kritisiert das althergebrachte, elitäre „Standesdenken“ und die überkommene Auffassung von „Standeswürde“. Er spricht lieber von „Solidarität“ und „Kollegialität“. Er stellt zunächst fest (S. 34):
- Ein Stand ist eine Gemeinschaft mit irrationalen Bindungen und einer Standesehre.
- Der Anwaltsstand ist in seiner offiziellen Doktrin (Rechtsprechung der Ehrengerichte) ein solcher „Stand“.
- Die Entwicklung der Kultur führt zu einer kritischen Haltung, zu einem Zweifel an Autorität, an Beständigkeit, zu gewerkschaftlichen Zusammenschlüssen.
Er bezeichnet die Vorstellung einer besonderen Standeswürde als Ideologie. Die Idee, dass eine „irrationale Gemeinschaft eines Standes existiere und durch williges Aufsichnehmen eines teilweise altmodischen Moralkodex getragen werden müsse, ist eine Vorstellung, die in dem jungen Anwalt nicht mehr zu wirklichem Leben erweckt werden kann“. (S. 37). Nur ein solches Verhalten könne geahndet werden, das den Anwalt zur Erfüllung seiner Berufspflichten ungeeignet erscheinen lasse, hierbei seien lediglich die „aus den speziellen Erfordernissen des Anwaltsberufs resultierenden Sonderpflichten“ von Bedeutung, nicht aber „allgemeine, rein persönliche Moralfragen“ (S. 44). Diese Sonderpflichten ließen sich aus Fragen der Kollegialität besser und sinnvoller ableiten als „im Rahmen einer heute blutleer gewordenen ständischen Ideologie“ (S. 47)
Beispielhaft geht Bauer-Mengelberg auf das schon damals kontrovers diskutierte Thema „Reklame“ ein. Vom Standpunkt der „Standeswürde“ erscheine bisher jede Reklame unzulässig. Es sei aber schlechterdings „nicht einzusehen, warum sich die Anwaltschaft einem Mittel verschließen soll, das von allen Erwerbskreisen als denkbar zweckmäßig betrachtet wird“. Aber gerade bei dieser Frage gelte die „Grenze der Kollegialität“. Art und Umfang der Werbemaßnahmen sollten innerhalb der örtlichen Anwaltvereine abgesprochen werden (S. 57).
Nach wie vor aktuell ist seine Klage im Hinblick auf die Überalterung der zuständigen Gremien. Zwar komme es auf das Lebensalter nicht entscheidend an. „Auch ein Fünfziger kann modern, auch ein Dreißiger altmodisch sein.“ Aber im allgemeinen gelte doch, dass „die jüngeren Anwälte fortschrittlicher sind“ (S. 60).
In der Zusammenfassung schreibt Bauer-Mengelberg:
„Ein Ideal muss geopfert werden, weil die Verhältnisse es verlangen. Die starre Standesdoktrin isoliert die Anwaltschaft und gräbt ihr die Verbindung zu denjenigen Kreisen ab, auf die sie angewiesen ist. Ein Aufbau auf moderner solidarischer Grundlage dagegen ermöglicht elastische Anpassung an die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten unserer Zeit“ (S. 62).
Leider hat Hannes Siegrist in der oben zitierten Studie die Schrift von Bauer-Mengelberg nicht gewürdigt. Seine Analyse und die Schlussfolgerungen, die er für ein zeitgemäßes Selbstverständnis des Anwaltsberufes zieht, waren seinerzeit wegweisend und bieten auch heute noch Stoff zum Nachdenken. Dass der Deutsche Anwaltverein solchen Überlegungen Raum gegeben hat, spricht durchaus für ihn. Wirkkraft konnte die „Streitschrift“ aber nicht mehr entfalten. Vielmehr gewannen in den letzten Jahren der Weimarer Republik konservative Kräfte in der Anwaltschaft an Einfluss, und mit Beginn der NS-Zeit war für fortschrittliche berufssoziologische Überlegungen ohnehin kein Platz mehr. Der Autor musste Deutschland verlassen und ist wohl auch nicht mehr zurückgekehrt.
Leider wissen wir auch nicht, was Max Friedlaender über die Thesen seines jungen Kollegen gedacht hat. Der Anmerkung 1) zum „Exkurs II zu § 28“ in der im Spätsommer 1929 abgeschlossenen 3. Auflage seines Kommentars zur Rechtsanwaltsordnung kann man entnehmen, dass (unter anderem) die Broschüre von Bauer-Mengelberg „noch nicht berücksichtigt werden konnte“.
Dr. Tillmann Krach